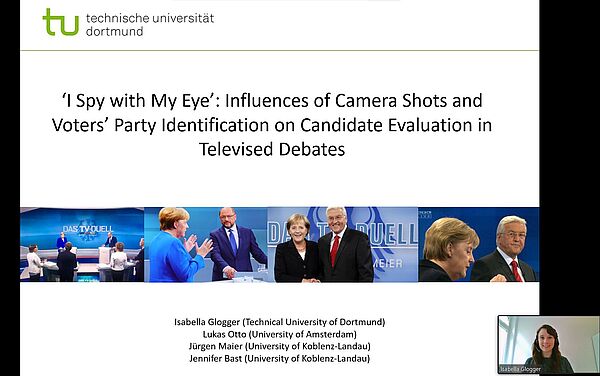Heute ist die Jahreskonferenz der International Communication Association (ICA) gestartet. Eigentlich hätte die australische Gold Coast der Austragungsort sein sollen – coronabedingt findet die Konferenz nun virtuell und aufgrund der unterschiedlichen Zeitzonen asynchron statt. In den nächsten sechs Tagen können alle KonferenzteilnehmerInnen sich die vorbereiteten Video-Präsentationen anschauen und kommentieren.
Auch das IJ ist mit mehreren Beiträgen vertreten.
Einfluss von Kameraeinstellungen bei TV-Duellen
Isabella Glogger, Akademische Rätin a.Z. am IJ, präsentiert gemeinsam mit Jürgen Maier (Universität Koblenz-Landau), Lukas Otto (Universität Amsterdam) und Jennifer Bast (Universität Koblenz-Landau) die Ergebnisse eine Studie, in der sie den Einfluss von Kameraeinstellungen, d.h. Einstellungsgrößen und -winkel, auf die Bewertung von Kandidaten aus der Politik in TV-Duellen unter die Lupe genommen und überprüft haben, ob es Unterschiede dieses Effekts abhängig von der Parteiidentifikation der Zuschauer gibt. Dazu verknüpften sie Daten von Inhaltsanalysen, Befragungen und Real-Time-Response-Messungen von vier deutschen TV-Duellen.
Ein Ergebnis der Studie: Kandidaten werden besser bewertet, wenn sie frontal gefilmt werden, weitere Effekte sind aber abhängig von den gezeigten Kandidaten und der Parteiidentifikation der bewertenden Zuschauer.
MILLA für die Analyse von Nachrichtenmedieneffekten
In einer weiteren Studie, die Isabella Glogger mit Lukas Otto (Universität Amsterdam), Fabian Thomas (Universität Koblenz-Landau) und Claes de Vreese (Universität Amsterdam) durchgeführt hat, geht es um sogenannte Linkage-Analysen, also Studien, die Inhaltsanalysedaten für Nachrichtenmedien und Befragungsdaten aus Selbstberichte kombinieren. Diese Studien wurden lange als Goldstandard für (Nachrichten-) Medieneffekte angesehen.
Isabella Glogger und ihre Kollegen zeigen, dass dieses empirische Design bei der Anwendung auf Nachrichtenmedieneffekte im digitalen Zeitalter vor großen Herausforderungen steht. Deshalb schlagen sie das Verfahren Mobile Intensive Longitudinal Linkage Analysis (MILLA) vor. Hier kann eine innovative Kombination aus Smartphone-Daten-Spenden genutzt werden, um die Medieninhalte, unmittelbare Reaktionen auf diese Inhalte und generelle Einstellungen der Teilnehmer gemeinsam erfassen zu können.
Quellenvielfalt in Google-News-Suchergebnissen
Stephan Mündges, wissenschaftlicher Mitarbeiter am IJ, beschäftigt sich in seinem Vortrag mit Quellenvielfalt in Google News-Suchergebnissen. In seiner Studie, die aus einer Kooperation mit der Dortmunder SEO-Firma Trisolute entstanden ist, hat er vergleichend für die USA, Großbritannien, Deutschland und Frankreich über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren untersucht, welche Nachrichtenseiten am häufigsten in Google-Suchergebnissen auftauchen. Damit konnte er u.a. zeigen, dass in allen Ländern die Liste der am besten rankenden Publisher sehr stabil ist.
Analyse der Nachrichtenselektion mit Hilfe von Eye-Tracking-Daten
Jakob Henke, wissenschaftlicher Mitarbeiter am IJ, stellt in seinem Vortrag eine Studie vor, die im Rahmen seiner Dissertation entstanden ist. Mit Hilfe von Eye-Tracking-Daten untersuchte er die Entscheidungsprozesse von Rezipienten bei der Auswahl von Nachrichten.
Er konnte zeigen, dass diese Entscheidungen selbst bei hoher Relevanz für die Rezipienten sehr schnell ablaufen und nur mit geringem kognitiven Aufwand verbunden sind. Beides deutet darauf hin, dass die Nachrichtenselektion maßgeblich von Heuristiken geleitet wird. Das Poster zu seinem Vortrag findet sich hier.
Nutzungsintention von Gesundheitsapps
In einem weiteren Vortrag berichtet Jakob Henke gemeinsam mit Sven Jöckel (Universität Erfurt) und Leyla Dogruel (Universität Mainz) von einer Studie über die Nutzungsintention von Gesundheitsapps. Die Forscher untersuchten, inwiefern die Neigung zu sozialen Vergleichen sowie persönliche Meinungen zur Privatsphäre das Preisgeben von Informationen in solchen Apps beeinflussen. Sie konnten zeigen, dass Menschen, die stärker zu sozialen Vergleichen neigen, bereit sind, mehr Daten preiszugeben und personalisierte Angebote zu nutzen.
Plattformen, Intermediäre, soziale Netzwerke - neues Modell für bessere Abgrenzung
Stefanie Fuchsloch, wissenschaftliche Mitarbeiterin am IJ, präsentiert in ihrem Vortrag ein Modell für Online-Medientypen. Traditionelle Mediensysteme sind bislang auf zwei Medientypen ausgerichtet: Rundfunk und periodisch gedruckte Presse. Seit dem Web 2.0 treten jedoch vermehrt hybride Medientypen und Akteure auf, welche die traditionellen Medienordnungen hinsichtlich ihrer Definition und Abgrenzung herausfordern. Auf europäischer Ebene im Rahmen der digitalen Binnenmarktstrategie - und auch auf nationalen Ebenen (bspw. Netzwerkdurchsetzungsgesetz in Deutschland) - zeigen sich die schwierige Abgrenzung der Begrifflichkeiten wie Plattformen, Intermediären oder sozialen Netzwerken.
Hier soll das stufenbasierte Modell zu einer besseren Abgrenzung beitragen. Anhand von sechs Stufen, wie Zugang oder Vermittlung, werden weitere Kriterien angeknüpft, um die verschiedenen Dienste deutlicher voneinander abzugrenzen für weitere politische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Debatten.