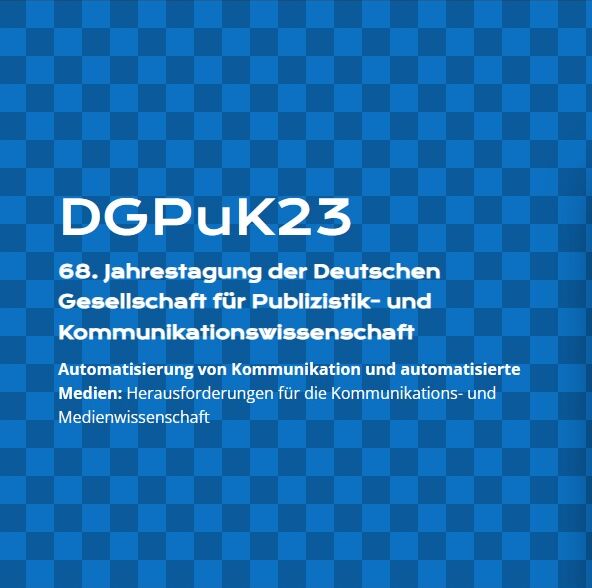Auf Einladung des Zentrums für Medien-, Kommunikations- und Informationsforschung werden sich vom 18. bis 20. Mai 2023 mehr als 300 Fachvertreter:innen mit dem Wandel digitaler Kommunikation beschäftigen.
Das Institut für Journalistik und das Erich-Brost-Institut für internationalen Journalismus werden mit den folgenden Vorträgen und Workshops auf der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft (DGPuK) vertreten sein:
„Forschungsethische Herausforderungen der automatisierten Analyse digitaler Datenspuren“
Eva-Maria Roehse und Prof. Dr. Wiebke Möhring vom IJ stellen gemeinsam mit ihren Kolleginnen aus dem FeKoM-Projekt Prof. Dr. Daniela Schlütz und Dr. Arne Freya Zillich (beide Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF) sowie Dr. Elena Link (Johannes Gutenberg-Universität Mainz) Ergebnisse aus Leitfadeninterviews vor zu den Fragen, welche forschungsethischen Herausforderungen Forschende bei der automatisierten Analyse von digitalen Datenspuren wahrnehmen und wie sie damit umgehen.
Die Ergebnisse zeigen, dass die Interviewten (n = 15) die automatisierte Analyse von Kommunikation als einen Fortschritt der Wissenschaft grundsätzlich begrüßen, um empirische Muster in aggregierten digitalen Datenspuren zu erkennen und so ein umfassenderes Bild kommunikativen Verhaltens abbilden zu können. Herausforderungen sehen die Teilnehmenden vor allem in der Anonymisierung der automatisch erhobenen Daten, in der Frage, ob und unter welchen Umständen eine informierte Einwilligung angenommen werden kann und im Umgang mit sensiblen Daten wie Klarnamen oder sexuellen Präferenzen. Zudem verdeutlichen die Befunde, dass die interviewten Forschenden erste lösungsorientierte Strategien entwickelt haben, um diesen Herausforderungen zu begegnen, die allerdings meist auf ihrer Forschungspraxis und weniger auf systematischen Informationen basieren.
„Das Marktpotential journalistischer Plattformen in Deutschland“
Im Unterschied zum Musik- oder Filmmarkt hat sich im Journalismus bislang keine vergleichbar erfolgreiche Plattform etablieren können, die Inhalte verschiedener Verlage zu einem Gesamtpaket bündelt und die zu einem monatlichen Festpreis abonniert werden kann. Ausgehend von dieser Beobachtung untersucht die Studie von Lukas Erbrich und Prof. Dr. Frank Lobigs vom IJ sowie von Dr. Christian Wellbrock (Hamburg Media School) und Jun.-Prof. Dr. Christopher Buschow (Bauhaus-Universität Weimar) auf Basis drei sich ergänzender Schätzmethoden das Erlöspotential verschiedener Modelle einer solchen anbieterübergreifenden, abonnementbasierten Journalismusplattformen am deutschen Markt.
Dazu wurden zwei Repräsentativbefragungen der deutschen Online-Bevölkerung mit insgesamt 8.000 Teilnehmenden durchgeführt. Die Ergebnisse der Befragungen zeigen, dass eine solche Plattform einen erheblichen Markterweiterungseffekt im Bereich der digitalen Abonnementverkäufe um bis zu 40 Prozent gegenüber den Einzelangeboten von Verlagen zeitigen würde. Da dieser Effekt alle Bevölkerungsschichten weitgehend gleichmäßig betrifft, besteht das Potential, mit einer anbieterübergreifenden Journalismusplattform auch diejenigen Bevölkerungssegmente zu erreichen, die sich aktuell vom Journalismus abzuwenden drohen.
„Deliberative Öffentlichkeit in Europa“
Unter dem Titel "Deliberative Öffentlichkeit in Europa: Mediale Schlüsselfaktoren – und der Beitrag der Kommunikationswissenschaft. Monitoring- und Forschungskapazitäten 14 europäischer Länder im Vergleich" präsentiert Marcus Kreutler, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Erich-Brost-Institut, in einem zusammen mit Prof. Dr. Susanne Fengler eingereichten Beitrag Ergebnisse des Mediadelcom-Projekts (mediadelcom.eu). Das Horizon 2020-Projekt untersucht Risiken und Chancen für deliberative Öffentlichkeit in 14 europäischen Ländern.
Nach einem Gesamtüberblick über das methodische Vorgehen des Projekts fokussiert der Vortrag auf Länderfallstudien zu den Monitoring-Kapazitäten: Er fragt, wie umfassend und regelmäßig in den unterschiedlichen Ländern Daten zu Journalismus, Medienregulierung, Mediennutzung und Medienkompetenzen erhoben werden. Dabei wird deutlich, dass die Situation in Deutschland im Ländervergleich als insgesamt positiv zu bewerten ist. Defizite bestehen hier weniger in den vier genannten Bereichen als bei Daten zur Institutionalisierung und Finanzausstattung akademischer Forschung.
Workshop „Forschungsethik in der Kommunikations- und Medienwissenschaft – Best Practice in der Forschungspraxis“
Das FeKoM-Team bietet auf der DGPuK Jahrestagung auch einen Methodenworkshop an. Im Vordergrund steht der Erfahrungsaustausch unter den Teilnehmenden und die Diskussion einer im Projekt erarbeiteten „Checkliste für eine prozessorientierte Vorgehensweise“ bei forschungsethischen Entscheidungen. Es soll gemeinsam diskutiert werden, inwieweit die Checkliste z. B. Erwartungen der Teilnehmenden entgegenkommt und ausreichend auf etwaige forschungsethische Fallstricke in der Methodenanwendung aufmerksam macht.
Ziel des offenen Formates ist es, mit Kommunikations- und Medienwissenschaftler*innen in den Austausch zu treten, eine Debatte in der Fachgesellschaft über Lösungsansätze und -möglichkeiten anzuregen und gemeinsam Best Practice-Ansätze zu eruieren.