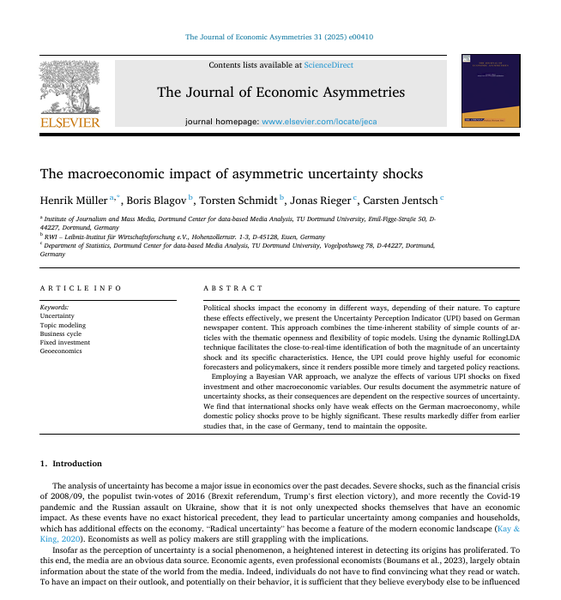Zusammen mit Ökonomen innerhalb der Universitätsallianz Ruhr forscht Prof. Dr. Henrik Müller an der Messung von ökonomischen Narrativen und den Wechselwirkungen zwischen Medienberichterstattung und wirtschaftlicher Entwicklung. Anfang März ist ein neues Paper über die „makroökonomischen Auswirkungen von asymmetrischen Unsicherheitsschocks“ erschienen. Im Kurzinterview erzählt er, warum er die Ergebnisse angesichts der aktuellen geopolitischen Lage für hochgradig relevant hält.
Professor Müller, Sie forschen über die ökonomische Wirkung von Berichterstattung. Das klingt nach empirischer Wirtschaftsforschung. Was hat das mit Journalismus zu tun?
Eine ganze Menge. Im Kern vermessen wir Medienöffentlichkeiten über lange Zeiträume. Dafür verwenden wir große Datenmengen – im genannten Paper sind das rund drei Millionen Zeitungsartikel –, die wir mittels komplexer statistischer Verfahren unter bestimmten Fragestellungen analysieren. Ein Ansatz, den auch die Journalismusforschung verfolgt. Bei uns kommt hinzu, dass die Ergebnisse in empirische volkswirtschaftliche Modelle einfließen – und sie dadurch besser machen. Bei uns hat sich eine sehr produktive Arbeitsteilung entwickelt: Wir analysieren die Medienberichterstattung mit Methoden, die wiederum unsere Kollegen aus der Statistik im Rahmen unseres DoCMA-Verbunds entwickelt haben. Kollegen aus der Ökonomik – bei dem aktuellen Paper waren Wirtschaftsforscher vom RWI in Essen beteiligt – testen dann den Erklärungsgehalt mit ökonometrischen Verfahren. Bei der Interpretation der Ergebnisse komme ich dann wieder ins Spiel. Das ist eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit, die da im Rahmen unserer Narrative Economics Alliance Ruhr (NEAR) entstanden ist.
In Ihrem aktuellen Paper messen Sie wirtschaftliche Unsicherheit auf Basis von Medienberichterstattung. Wo sehen Sie da den Zusammenhang?
In der Berichterstattung finden sich alle möglichen Entwicklungen und Ereignisse, die außerhalb des Erklärungspotenzials von ökonomischen Modellen liegen. Indem wir entsprechende Artikel herausfiltern und dann thematisch sortieren, können wir die unterschiedlichen Quellen von wirtschaftlicher Unsicherheit benennen und über die Zeit verfolgen. In dem genannten Paper zeigen wir, dass unterschiedliche Arten von Unsicherheit ganz unterschiedliche Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft haben.
Zum Beispiel?
Geopolitische Unsicherheit spielt eine weitaus geringere Rolle für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland, als man bislang dachte. Viel wichtiger ist die nationale Politik. Was in Berlin entschieden wird – oder auch nicht –, hat den größten Einfluss auf die Investitionen von Unternehmen und das Konsumverhalten der Bevölkerung. Auch gesellschaftliche Entwicklungen, wie die Pegida- oder die „Querdenker“-Proteste, haben signifikante Effekte.
Das klingt nicht sonderlich überraschend.
Vielleicht. Aber wir können diesen Einfluss jetzt mit ordentlichen statistischen Verfahren nachweisen und beziffern. Das ist ein Wert an sich.
Wir durchleben derzeit eine Phase massiver Unsicherheit: Die Weltordnung der vergangenen 80 Jahre bricht auseinander. Und das soll keinen Einfluss auf die Wirtschaft haben?
Doch, natürlich. Aber im Kern geht es um die Frage, ob wir als Gesellschaften in der Lage sind, mit der gestiegenen Unsicherheit umzugehen. Passen unsere Institutionen noch zu den veränderten Erfordernissen? Da ist die Antwort ganz klar: nein. Die Aufgabe besteht deshalb darin, unsere Institutionen so umzubauen, dass sie Deutschland und die EU insgesamt in einem unkalkulierbaren geopolitischen Umfeld widerstandsfähig machen. Das würde uns auch ökonomisch nützen, wie unsere Ergebnisse zeigen.
Was haben Studierende davon, wenn Sie sich mit dieser Art von Forschung befassen?
Zum einen fließen die Ergebnisse in die Lehre ein. Sie bieten gesicherte Erkenntnisse über die Wirkung von Journalismus. Daraus lassen sich normative Schlüsse ziehen – nach dem Motto: Was könnten und sollten wir künftig besser machen? Zum anderen haben fortgeschrittene Studierende die Möglichkeit, die genannten Verfahren zu erlernen und damit im Rahmen von Abschlussarbeiten selbst Beiträge zur Forschung zu erarbeiten. Auf Masterniveau führt das gelegentlich zu ordentlichen wissenschaftlichen Veröffentlichungen auf internationalem Niveau – was für alle Beteiligten ziemlich cool ist.